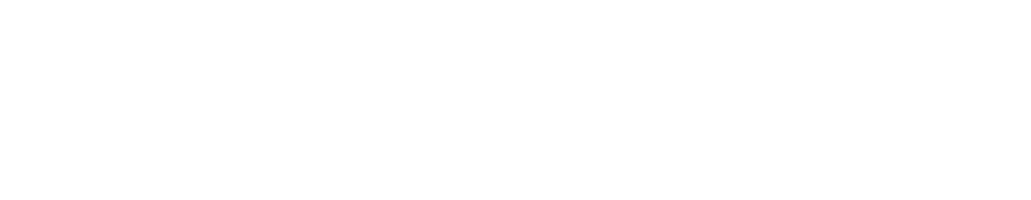Forschung Retinadegeneration
Neue Therapien für erbliche Netzhauterkrankungen?
Neue Erkenntnisse über die Entstehung hereditärer degenerativer Netzhauterkrankungen standen Ende März im Mittelpunkt des 3. internationalen Pro Retina-Forschungskolloquiums „Retinal Degeneration: Genes – Progression – Therapy“, das die „Pro Retina Stiftung zur Verhütung von Blindheit“ in Potsdam veranstaltete. Rund 150 Wissenschaftler diskutierten bei der Tagung neue Erkenntnisse der Grundlagenforschung mit Hinblick auf therapeutische Perspektiven. Die Referenten präsentierten neben neuen Einsichten in die Genetik und Pathophysiologie erblicher Netzhauterkrankungen auch Konzepte für Stammzell-basierte und gentherapeutische Therapiestrategien. Anlässlich des Symposiums stellte sich Prof. Dr. Klaus W. Rüther, Augenklinik der Berliner Charité und Mitver-anstalter des Symposiums, dem Gespräch.
Wie häufig sieht ein niedergelassener Augenarzt Patienten mit hereditären Retinaerkrankungen wie Retinitis pigmentosa?
Das ist natürlich spekulativ, aber ich schätze, etwa einmal im Jahr.
Worauf kommt es bei der Diagnostik dieser Erkrankungen an, wenn ein Patient sich zum ersten Mal vorstellt?
Zunächst gilt es abzuklären, ob Veränderungen des Sehens überhaupt durch eine Netzhauterkrankung verursacht werden. Alleine diese Diagnose zu stellen ist manchmal gar nicht so einfach. Zur genauen Diagnose gehört u.a. die Differenzierung zwischen einer stationären Erkrankung und einer progressiven. Handelt es sich um eine progressive Erkrankung, dann muss man genau die Art eingrenzen. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist dies wichtig für die Prognose und zweitens kann nur so bei Bedarf eine genetische Untersuchung initiiert werden. Ohne die Eingrenzung der klinischen Diagnose ist eine genetische Untersuchung sinnlos.
Welche Untersuchungsmethoden sind obligat?
Obligat ist in jedem Fall das Elektroretinogramm, um die Art der Photorezeptorkrankheit festzulegen. Routine für Folgeuntersuchungen sind insbesondere Gesichtsfelduntersuchungen, Sehschärfebestimmungen, das Anschauen des Augenhintergrundes und andere morphologische Untersuchungen.
Wann ist denn eine genetische Untersuchung der Familie indiziert?
Da gibt es verschiedene Situationen. Das früher häufigste Szenario war, dass wir als Forscher, insbesondere Genetiker, Interesse daran hatten, Patienten zu finden, die bereit waren, ihr Blut zu geben, um die genetische Forschung weiter zu bringen. Das ist auch heute noch zum Teil der Fall. Wenn man aber klinisch denkt, das heißt, wenn man sich fragt, was die Patienten davon haben, dann gibt es für mich zwei wichtige Situationen. Im Mittelpunkt der einen steht eine frühkindliche Netzhautdystrophie. In diesem Fall muss man mit den Eltern besprechen, dass eine Diagnosesicherung, zu der in bestimmten Fällen auch eine genetische Absicherung gehören kann, natürlich die Voraussetzung ist für eine genetische Beratung. Wenn ein Elternpaar wissen will, wie hoch das Risiko für weitere betroffene Kinder ist, dann ist die genetische Untersuchung nötig. Die andere Situation trifft eher bei erwachsenen Patienten zu: Wir wollen die Patienten davon überzeugen, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, den Genotyp für zukünftige Therapien zu kennen. Denn eine Gentherapie ist nur auf einen Genotyp zugeschnitten. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass auch unspezifische Therapien etwa bei Pigmentepitelerkrankungen möglicherweise nur bei bestimmten Genotypen sinnvoll sind. Deshalb muss man auch in solchen Fällen den Genotyp kennen. Darum halten wir es grundsätzlich für sinnvoll, eine genetische Untersuchung machen zu lassen. Bei bestimmten Erkrankungen kann man die bekannten Mutationen screenen, inzwischen relativ einfach, und in der Regel werden solche Untersuchungen auch von den Kostenträgern übernommen.
Können die neuen Erkenntnisse der Molekularbiologen erklären, warum die Prognose der verschiedenen Erkrankungen von Fall zu Fall so variabel ist?
Unsere Kenntnisse darüber sind noch unzureichend, doch es gibt erste Einsichten. Ein Beispiel sind Mutationen im Peripherin-Gen, die zur Netzhautdegeneration führen. Eine Mutation kann innerhalb einer Familie zu ganz unterschiedlichen Krankheits-bildern und auch Schweregraden führen. Manche Betroffene bemerken die Erkrankung gar nicht und manche bemerken sie sehr früh. Natürlich können auch Umweltfaktoren bei unterschiedlichen Verläufen eine Rolle spielen, wobei sich diese zumindest innerhalb einer Familie häufig nicht sehr stark voneinander unterscheiden. Auch die Untersuchung einer Familie mit Morbus Stargardt, die hier auf dieser Tagung präsentiert wurde, zeigt, dass in einem Gen verschiedene Mutationen (ABCA4-Mutationen) jeweils unterschiedliche Erkrankungsverläufe verursachen kann. Darüber hinaus ist mittlerweile auch klar, dass ganz andere Gene einen Krankheitsverlauf bestimmen können, aber auch Gensequenzen, die etwas mit der Regulation der Gene zu tun haben, nicht aber direkt mit der Geninformation.
Wie hilfreich sind die Tiermodelle?
Tiermodelle sind die wichtigste Voraussetzung, um die Pathophysiologie und die Therapie verstehen oder erproben zu können. So ist es beispielsweise erst jetzt gelungen, für die Choroideremie, eine relativ schwer verlaufende Krankheit, durch einen sehr klugen Mechanismus ein Tiermodell zu kreieren. Und wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass sehr viele Erkenntnisse, die wir aus den Tiermodellen über die erblichen Formen der Retinopathien gewinnen, uns auch bei den erworbenen, sehr viel häufigeren Formen voranbringen werden, etwa der Altersassoziierten Makuladegeneration (AMD).
Gibt es ein konkretes Beispiel dafür?
Ein Beispiel ist der Morbus Stargardt und die dafür verantwortlichen ABCA4-Mutationen. Wir wissen, dass es bei dieser Krankheit zu Lipofuscin-Ablagerungen und zu toxischen Schädigung der Zellen kommt. Ähnliche Prozesse laufen auch bei der AMD ab. Das eine ist eben die juvenile Form und das andere die im Alter auftretende Form der Makuladegeneration. Bei der trockenen Makuladegeneration müsste der Zellverlust gestoppt werden, um die Progression der Erkrankung zu bremsen. Wenn es durch die Forschung mit Tiermodellen gelingt, diesen Zelltod aufzuhalten, dann ist das für die trockene AMD von ganz großer Relevanz.
Wie lange wird es Ihrer Schätzung nach dauern, bis aus solchen Forschungsansätzen praktisch verwertbare Therapien resultieren?
Das ist natürlich spekulativ; aber aufgrund der Studienlage kann man eigentlich den Patienten guten Gewissens sagen, dass wir damit in etwa zehn Jahren rechnen. Das ist eine gute Zeitspanne für all jene, die wir jetzt im Kindes- und Jugendalter diagnostizieren und die noch eine relativ gute Netzhautfunktion haben. Wenn heute ein Patient mit 20 Jahren noch ein nachweisbares ERG hat und einen Gesichtsfeld von 20 Grad, kann man eigentlich ziemlich sicher sagen, dass der bis zum Alter von 40 bis 45 Jahren zurecht kommen wird. Und unsere Hoffnung ist, dass wir bis dahin wirksame Methoden haben, um die Progression der Erkrankung zu stoppen.
Die Pro Retina-Stiftung zur Verhütung von Blindheit wurde 1996 gegründet und hat die Aufgabe, die Forschung auf dem Gebiet der Netzhauterkrankungen zu fördern. Sie stellt finanzielle Fördermittel zur Verfügung, um Forschungsprojekte voranzubringen und um wichtige Vorhaben anzuschieben. Das langfristige Ziel ist, dazu beizutragen, dass Wissenschaftler und Ärzte wirksame Therapien zur Behandlung von Netzhaut-erkrankungen entwickeln können. Sie ist eine Stiftung der Selbsthilfeorganistaion Pro Retina Deutschland e.V., die 1977 von Betroffenen und deren Angehörigen mit der Absicht gegründet wurde, sich selbst zu helfen. Sie besteht heute aus 65 Regionalgruppen, die bundesweit verteilt sind und hat zurzeit ca. 6.400 Mitglieder.