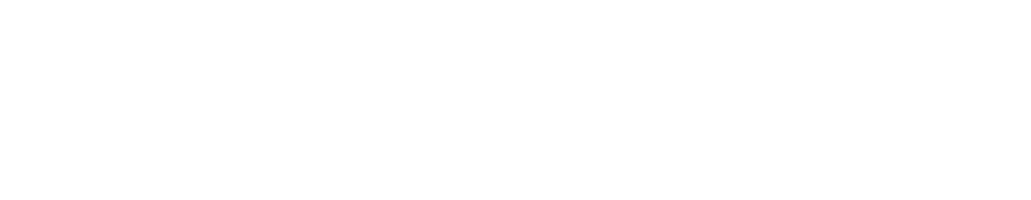Die XXIII. Zusammenkunft der Julius-Hirschberg-Gesellschaft in Heiden (Schweiz) Teil 2

Von Friedensnobelpreisträgern, Augenärzten und Medizinhistorikern
Im zweiten Teil des Nachberichtes zur XXIII. Zusammenkunft der Julius-Hirschberg-Gesellschaft in Heiden fasst Dr. Sibylle Scholtz die Vorträge der Referenten zu historischen Biografien, aber auch beispielsweise zum „bösen Blick“, dem Xenonphotokoagulator oder zu Themen wie dem Schicksal verfolgter Ophthalmologen während des Nationalsozialismus zusammen.
Karl Stülpner: Wildschütz, Volksheld und Kataraktpatient
Als erster Referent im zweiten Tagungsteil, der mit seinem Vortrag „Zur Cataract-Operation beim erzgebirgischen Wildschützen Karl Stülpner (1762–1841)“ die Teilnehmer nach der Mittagspause aus der postprandialen Müdigkeit wirkungsvoll rettete, sprach Priv.-Doz. Dr. Manfred Jähne aus Schneeberg. Die am meisten mit Legenden umwobene Person des Sächsischen Erzgebirges war Karl Heinrich Stülpner. Als Wildschütz war er ein erzgebirgischer Volksheld und ist als verwegener Jäger und Beschützer der Armen etwa gleich zu setzen mit Robin Hood in England. Stülpner lebte in einer Zeit historischer Umbrüche in Europa: Die Französische Revolution mit den Kriegen Napoleons, anschließend die Befreiungskriege. Im Kurfürstentum, ab 1806 Königreich Sachsen, herrschte soziale Ungerechtigkeit, es begann die Industrialisierung. Stülpner wurde als achtes Kind einer Tagelöhnerfamilie 1762 in Scharfenstein nahe Zschopau geboren. Seit 1780 war er kursächsischer Musketier und seit 1785 ständig auf der Flucht, desertierte mehrfach und wechselte dann oft zwischen Sachsen und Böhmen seinen Unterschlupf. Als treffsicherer Schütze versorgte er für seinen Lebensunterhalt Reiche und hohe Militärs mit Wildbret. Ab 1828 „traf ihn das große Unglück, durch den Staar zu erblinden“. Chronisten schrieben, dass sich „Stülpner 1831 beim Wundarzt und Stadtrichter Seyfarth in Mittweida der Star-Operation unterzog und danach auf dem linken Auge wieder sah“. Abbildungen mit einer Starbrille zierten später Stülpners autobiografisches Buch. Er starb 1841 völlig verarmt und entkräftet in seinem Geburtsort. Die Vita des Christian Gotthold Seyfferth (1772-1831), Medicinae Practicus und Stadtrichter in Mittweida, wird anhand von Archivunterlagen und einer Chronik dargestellt. Auch der Sponsor dieser 25 Taler teuren Operation ist bekannt. Es ist anzunehmen, dass der Augenoperateur Seyfferth in der vor Graefe-Ära sich dieser Methode der Extractio cataractae bediente, wie sie im „Lehrbuch der Ophthalmologie“ von Christian Georg Theodor Ruete (1810-1867), seit 1852 erster Ordinarius für Augenheilkunde in Leipzig, später publiziert wurde.
Von Graefes Beobachtungen zur Vitamin-A-Mangelerkrankung
Klassisch aus dem Bereich der Tropenophthalmolgie berichtend war Prof. Dr. Guido Kluxen mit „Erste Beobachtungen, die richtungweisend zur Entdeckung der Vitamin-A-Mangelerkrankung führten“ aus Wermelskirchen angereist. Albrecht von Graefe ist an Beobachtungen, die richtungweisend zur Entdeckung der Vitamin-A-Mangelerkrankungen führten, mitbeteiligt. Doch zu seinen Lebzeiten hatte man noch keine Kenntnisse über einen Vitamin-A-Mangel und die Ursache der altbekannten Xerophthalmie (Austrocknungen der Augenoberfläche) lag noch völlig im Dunkeln. Eigentlich begann man erst 30 Jahre später langsam zu erahnen, dass die Ursache etwas mit einem Mangel einer Substanz im Stoffwechsel zu tun hatte. Albrecht von Graefe sah bis zu vier schwere Fälle von doppelseitigen Keratomalazien (Hornhauterweichungen) pro Monat in seiner Klinik in Berlin bei Säuglingen, die alle aus einem unbekannten Grund verstarben. Aus den Sektionsbefunden zweier seiner kleinen Patienten gab es einen Hinweis, dass die Ursache an einer diffusen Enzephalitis gelegen haben könnte. Es war der von Graefe-Schüler Theodor Leber (1840-1917), der einige Jahre nach von Graefes Tod diesen Befund richtig stellte. Die Kinder waren schlecht ernährt und appetitlos, hatten grünliche Durchfälle abwechselnd mit Verstopfung, aber keine ausgeprägten Hirnsymptome. Sie verfielen gewöhnlich während des Verlaufs der Augenkrankheit zusehends und starben alle entweder unter zunehmendem Kräfteverfall und diarrhöischen Affektionen oder auch an Bronchopneumonie, schreibt von Graefe. Nur in einem Falle wurden wenige Tage vor dem Tode Konvulsionen und Somnolenz festgestellt. Von Graefe hat sich auf die Sektionsbefunde verlassen und die Möglichkeit geäußert, dass hier eine diffuse Enzephalitis die Ursache sein könnte. Doch das, was die Pathologen beschrieben hatten, war ein nicht als pathologisch anzusehender Befund, sondern faktisch ein Normalbefund bei Säuglingen. Der Tod der Kinder im zarten Alter beruhte auf ihrer Schwäche und Intestinal- und Lungenkomplikationen, wie es von Graefe bereits beschrieben hatte, und gingen mit Infektionen, dabei insbesondere aus der Palette der typischen kindlichen Infektionen zu einer Zeit, als die allgemeine Kindersterblichkeit noch hoch war, einher. Von Graefe hat selbst bei den Säuglingen Typhus und Scharlach erwähnt. Heute weiß man, dass die Ursache der Keratomalazie im Vitamin-A-Mangel liegt, da bei einer infektiösen Kinderkrankheit der Vitamin-A-Verbrauch ansteigt. Todesursache unter den Säuglingen bei von Graefe waren Unterernährung sowie infektiöse Kinderkrankheiten und mitbeteiligt an der Kindersterblichkeit war der allgemeine Vitamin-A-Mangel.
„Kopfwehloch“ und „böser Blick“
Die nächsten beiden Referent stammten ebenfalls aus der Schweiz: Dr. Markus O. Schreier (Solothurn) berichtete „Vom guten und bösen Blick“ und Doris Sonderegger-Marthy (Chur/Walenstadt) vom „Kopfwehloch in der Kapelle St. Georg, Berschis“. Schreier sprach in seinem Vortrag über eine kleinen Gruppe von 13 Augenpatienten, alle Immigranten aus Afghanistan, Süditalien, Griechenland, Haiti, Mexiko und der Türkei, die nach dem „Bösen Blick“ gefragt wurden. Orakel, ob Krankheitssymptome die Folge des bösen Blicks seien, Heilrituale und protektive Maßnahmen wurden erfragt. Die Heilrituale bewegen sich auf einer spirituell-religiösen Ebene je nach Ethnie mit katholischen, griechisch-orthodoxen oder islamischen Elementen. Das Auge als aussendendes und empfangendes Organ und seine Wirkung auf die Umwelt wurden diskutiert.
In einem zweiten Teil wurde versucht, den guten und den bösen Blick in einem größeren Zusammenhang zu erfassen. Das Kopfwehloch ist laut Sonderegger-Marthy in der Hinterseite des Altars der St. Georgen–Kapelle in Berschis, der ältesten Kapelle des Kantons St. Gallen zu finden. Diese Kapelle ist die einzige zweischiffige, romanisch gewölbte Gottesstätte nördlich der Alpen mit nur einer Apsis. Der erste schriftliche Nachweis eines Kopfwehloches stammt aus dem 17. Jahrhundert. Gläubige mit Kopfweh pilgerten zu dieser Kapelle, um Linderung von ihren Leiden zu erlangen, nachdem sie den Kopf betend und sich beugend in das Loch in der Rückseite des Altars gesteckt hatten. In der Schweiz und im nahen Frankreich finden sich weitere Kopfwehlöcher in Kirchenaltären: Kapelle St. Jost, Ennetbürgen (Kanton Nidwalden), Kapelle St. Placidus, Disentis (Kanton Graubünden) und in der Kirche von Saint-Dizier-l’Evêque, Frankreich, unweit von Pruntrut (Kanton Jura).
Johann Georg Waibel: Voralberger Bürgermeister und Augenarzt
In den Alpen zumindest blieb Priv.-Doz. Dr. Gregor Wollensak (Berlin) mit seinem diesjährigen Vortrag über „Johann Georg Waibel – Bürgermeister von Dornbirn und Augenarzt“. Johann Georg Waibel wurde am 28.8.1828 in Dornbirn (Vorarlberg) als ältester Sohn des Gemeindekassiers Josef Andreas Waibel geboren. Nach dem Besuch des Staatsgymnasiums in Feldkirch und des Lyzeums in Salzburg beteiligte er sich 1848 mit einer Kompanie von Tiroler Akademikern an den Gefechten bei Ponte Caffaro in Südtirol. 1849 bis 1850 studierte er unter anderem Medizin an der Universität München, von 1850 bis 1852 an der Humboldt-Universität in Berlin, wo es ihm so gut gefiel, dass er später den Beinamen „der Berliner“ bekam. Von 1852 bis 1856 setzte er sein Medizinstudium in Wien fort und erwarb dort das medizinische und chirurgische Doktorat. 1860 eröffnete er eine Praxis in Höchst/Vorarlberg in der Nähe des Bodensees, danach in Tschagguns im Montafon und schließlich 1863 in seiner Heimatstadt Dornbirn. Neben seinem Spezialgebiet der Augenheilkunde war Dr. Waibel auch als praktischer Arzt tätig und führte zum Beispiel Herniotomien durch. Außerdem war er auch als Gerichtsarzt mit Autopsien beschäftigt. Während dieser Zeit begründete er den „Dornbirner Turnverein“ und den „Verein der Ärzte von Vorarlberg“. Er war politisch bei den Liberalen engagiert und wurde am 16.2.1869 zum Bürgermeister von Dornbirn gewählt. Da er danach weniger Zeit zur Verfügung hatte, beschränkte er seine ärztliche Tätigkeit zunehmend auf die Augenheilkunde. Als Bürgermeister machte er sich unter anderem verdient um die Einführung eines gedruckten Gemeindeblattes, den Bau von neuen Schulen, ein neues Schulgesetz, die Erweiterung des Straßennetzes, den Bau einer Stickereifachschule und des neuen Postgebäudes und die Einführung einer Sparkasse. Von 1870 bis 1908 war er auch im Vorarlberger Landtag und von 1878 bis 1897 Mitglied des österreichischen Reichrates. Am 29.3.1883 heiratete er seine Frau Aurelia, diese starb 1903. Danach half ihm seine Nichte Sophie im Haushalt. Dr. Waibel pflegte gute und freundschaftliche Kontakte zu dem Vorarlberger Schriftsteller Franz Michael Felder und Franz Xaver Moosmann in Schnepfau, dem Herausgeber des „Bregenzerwälder Blattes“. Er starb am 22.10.1908 an den Folgen eines Schlaganfalls. Dr. Waibel war fast 40 Jahre lang Dornbirns Bürgermeister gewesen.
Die Gründung des „Club Jules Gonin“
Die vierte und letzte wissenschaftliche Sitzung startete mit Dr. Gerhard Keerl (Düsseldorf) mit dem Thema „Zur Gründung des Club Jules Gonin vor fünfzig Jahren“. Am Anfang war der Xenonphotokoagulator! Nachdem Prof. Gerd Meyer-Schwickerath („M-S“) in Hamburg Sonnenfinsternisschäden von 1946 beobachtet hatte, kam ihm der Gedanke, künstlich Narben an der Netzhaut zu erzeugen. Nach Jahren der Zusammenarbeit mit der Firma Zeiss Oberkochen konnte er 1957 den ersten klinisch erprobten Lichtkoagulator vorstellen. Zunächst war das Ziel, Makulalöcher und Netzhautrisse zu verschließen und rissverdächtigen Areale und umschriebene Netzhautablösungen abzuriegeln. In der Folge fanden an der Bonner Klinik unter seiner Leitung Einführungslehrgänge statt. Unter Mitwirkung der Augenklinik Lausanne konnte Meyer-Schwickerath vom 14. bis 17. September 1959 das „I. Kolloquium über die Photokoagulation“ mit internationaler Beteiligung von insgesamt 62 Teilnehmern organisieren. Die Tagung verlief sehr persönlich durch die Schweizer Gastgeber Professor Streiff und insbesondere Dr. René Dufour. Während der Tagung entstand der Gedanke, eine neue Gesellschaft zu gründen, die sich speziell mit der Netzhautpathologie befassen sollte. Am Ende der Tagung war aus dem Kolloquium über die Photokoagulation, und getauft auf den genius loci, die „I. Tagung des Club Jules Gonin“ geworden. Wenn auch der Xenonphotokoagulator durch verschiedene Laser, für die der Koagulator Pionier war, überholt worden ist, so entwickelte sich der Club Jules Gonin in Anpassung an die Fortschritte des Faches zu der bedeutenden Vereinigung von Spezialisten der vitreoretinochorioidalen Pathologie und Chirurgie.
100 Jahre Universitäts-Augenklinik Tübingen
Über „100 Jahre Universitäts-Augenklinik Tübingen“ sprach Prof. Dr. Jens Rohrbach (Tübingen). Nachdem Gustav von Schleich (1851-1928) den Tübinger Lehrstuhl für Augenheilkunde 1895 übernommen hatte, stellte er sehr bald fest, dass die bisherige, 1875 eingeweihte Augenklinik seines Vorgängers Albrecht Eduard Nagel (1833-1895) mit ihren 40 Betten den Anforderungen der Zeit nicht mehr genügte. Die Gründe hierfür waren insbesondere der erhebliche Fortschritt der Augenheilkunde im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts sowie die Einführung der Krankenversicherung 1883, die immer mehr Menschen den Zugang zu einer augenärztlichen Versorgung ermöglichte. So begann Gustav Schleich gemeinsam mit dem Oberbaurat Albert Beger aus Stuttgart zielstrebig mit den Planungen für einen Klinikneubau. Nachdem die Geldmittel im Juli 1905 bewilligt worden waren und der erste Spatenstich im April 1906 erfolgt war, nahm die neue Klinik den Betrieb am 1. Januar 1909 als „Königlich Württembergische Augen-Klinik Tübingen“ auf. Die ursprünglich projektierten Kosten in Höhe von 585.000 Reichsmark wurden um knapp 20 Prozent überschritten. Bei der Errichtung des Gebäudes war man den seinerzeit gültigen Bauprinzipien für Augenkliniken im Deutschen Reich weitgehend gefolgt. Es waren diese unter anderem die Ausrichtung der Gebäude-Längsachse in Ost-West-Richtung und die Trennung von ambulanter sowie stationärer Krankenversorgung, Lehre, Forschung und (dezentralisierten) Versorgungseinrichtungen durch horizontale und vertikale Gliederung des Gebäudes. Bei Erstbezug hatte die Klinik 110 Betten bei einem Personalbestand von 32 Personen. Seit der Inbetriebnahme wurde das Innere der im Jugendstil errichteten, heute unter Denkmalschutz stehenden Klinik wiederholt verändert, während die äußere Fassade bis auf einen Anbau nach Westen in den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts weitgehend original erhalten blieb. Die in der Klinik erbrachten wissenschaftlichen Leistungen haben nachhaltig zum Fortschritt der Ophthalmologie national wie auch international beigetragen. Die Feierlichkeiten zum 100. Jahr der Tübinger Augenklinik im Jahre 2009 standen nicht nur im Zeichen der dankbaren Rückschau, sondern machten darüber hinaus auch auf die Notwendigkeit eines Klinikneubaus in der näheren Zukunft aufmerksam.
Augenheilkunde im 3. Reich
Zwei weitere spannende Themen schlossen den Kongress ab: Dr. Peter Kober (Schwelm) präsentierte „Die augenärztliche Versorgung von Kriegsverletzungen bei der deutschen Wehrmacht im II. Weltkrieg 1939–1945“, Dr. Udo Henninghausen (Heide) berichtete über „Das Schicksal der verfolgten Ophthalmologen/-innen während der Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945), insbesondere das derjenigen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft; der aktuelle Stand eines laufenden Forschungsprojektes“. Laut Kober hat im Rahmen der Kriegschirurgie die Versorgung von Verletzungen der Augen sicher immer eine mehr oder weniger wichtige Rolle gespielt. Allerdings waren die Möglichkeiten wirklich wirkungsvoller Versorgung in früheren Zeiten noch sehr gering. Andererseits war auch die Zahl der Augenverletzungen in den Kriegen vergangener Zeiten geringer als, bedingt durch die veränderte Waffentechnik, in den Kriegen des 20. Jahrhunderts. Es fällt auf, dass es zwar sehr umfangreiche und detailreiche Einzelberichte über die Tätigkeit von Sanitätsdiensten an der Front und bei den rückwärtigen Einrichtungen der Versorgung Verwundeter gibt, eine systematische Darstellung des gesamten Sanitätswesens der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und damit auch der Bedeutung der Augenheilkunde dabei fehlt, während interessanterweise eine mehrbändige Darstellung des preußisch-deutschen Sanitätswesens sowohl für den Krieg 1870/71 als auch des deutschen für den Ersten Weltkrieg vorliegt. So kann sich eine Darstellung des oben genannten Themas nur darauf beschränken, einzelne Aspekte aufzugreifen und einzelne Persönlichkeiten zu nennen, sowie einen kurzen historischen Abriss der Entwicklung der wissenschaftlich fundierten Kriegschirurgie überhaupt zu geben.
Henninghausen beschrieb in seinem Vortrag, dass Rohrbach in seinem 2007 erschienenen Buch „Augenheilkunde im Nationalsozialismus“ über das Schicksal der Augenärzte und Augenärztinnen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft während dieser Zeit berichtet hat. Er beschränkte sich in seinem Buch vorwiegend auf die Vorgänge im Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 und stützt sich bei seinen Recherchen überwiegend auf die Mitgliederlisten der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Ziel dieser Studie nun war es, eine möglichst umfassende Untersuchung dieses Themas durchzuführen, welche über das von Rohrbach erforschte Gebiet hinausgeht. Zum Zeitpunkt der Anmeldung dieses Vortrages lagen Henninghausen, nach dessen Auskunft, Informationen über 57 Ophthalmologinnen und Ophthalmologen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft während der Zeit des Nationalsozialismus vor, während Rohrbach über etwa 40 Schicksale berichtete.

Von 17. bis 19. September 2010 findet unter der Obhut von Prof. Dr. Guido Kluxen (Wermelskirchen), der 2009/2010 als neuer Obmann der Gesellschaft fungiert, die XXIV. Zusammenkunft der JHG in Köln statt.